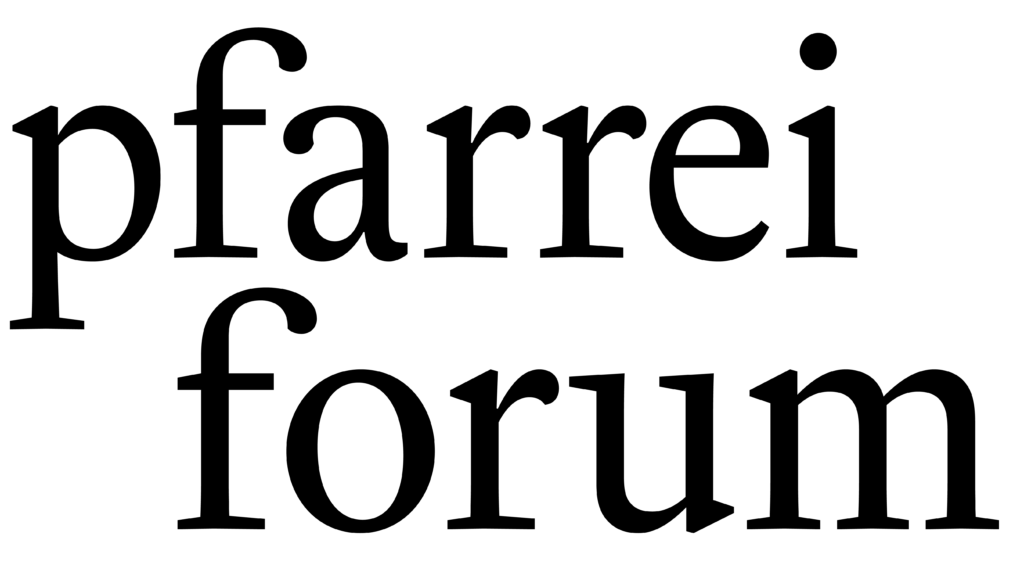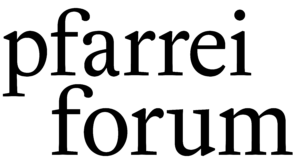Ein Lagerfeuer auf dem Olma-Wagen
Von der Anfrage bis zur Olma waren es nur ein paar Monate, die Zeit drängte: «Trotzdem stand für mich sofort fest: Die Chance, am Olma-Umzug teilzunehmen, darf sich Jubla nicht entgehen lassen», sagt Andrea Zünd (29) aus Widnau, OK-Präsidentin Jubla am Olma-Umzug und Mitglied der Jungwacht Blauring-Kantonsleitung. Widerstände und diverse Herausforderungen bewältigte sie mit einer grossen Portion «Jubla-Grundvertrauen».
In den ersten Tagen nach dem «Go» für das Projekt Jubla am Olma-Umzug lief bei Andrea Zünd das Telefon heiss. «Ich war sofort voller Tatendrang», sagt sie und lacht. «Eine Woche lang habe ich alle möglichen Leute kontaktiert und sie motiviert, beim Projekt mitzumachen.» Zu diesem Zeitpunkt waren noch viele Fragen offen: Lassen sich genügend Freiwillige finden, die mitmachen? Was genau kommt auf sie zu? Wie sieht der Wagen aus – und wo findet man so einen? Geholfen habe ihr dabei ihr Grundvertrauen. «Ich bin seit zwanzig Jahren bei der Jubla. In Gruppenstunden und Lagern kann es immer wieder einmal passieren, dass etwas nicht so läuft wie geplant. Man lernt zu improvisieren und weiss, dass es schliesslich mit ein bisschen Einsatz immer doch gut kommt. Die Jubla ist die beste Lebensschule.» Schon nach der ersten OK-Sitzung habe sich die anfängliche Nervosität beruhigt. In den letzten Monaten sei ihr eines neu bewusst geworden: «Auf das Netzwerk, das man in der Jubla knüpft, kannst du dich verlassen.» Sie sagt: «Die Jubla schweisst so viele verschiedene Menschen mit vielfältigem Know-how zusammen. Wenn man etwas braucht oder sucht, reichen oft ein paar WhatsApp-Nachrichten oder Anrufe und man landet bei einer Person, die weiterhelfen kann. Das war zum Beispiel auch so bei der Herausforderung, einen Wagen zu organisieren – und das möglichst kostenlos. Das Jubla-Motto ‹Lebensfreude und Lebensfreunde› hält, was es verspricht.»


Olma-Wagen bauen
Nebst der Suche nach einem Wagen mussten sich die zwölf OK-Mitglieder diesen Sommer einigen weiteren Herausforderungen stellen – und das alles in ihrer Freizeit. «Am Anfang wurde in unserem Gremium schon der eine oder andere Zweifel laut: Schaffen wir das in dieser kurzen Zeit? Bringt das was?» Finanzielle Fragen mussten geklärt und auch mit den Verantwortlichen des Olma-Umzugs verhandelt werden. «Zunächst hiess es, dass nur 25 Personen auf dem Wagen mitfahren dürfen. Aber in der Ostschweiz gibt es so viele Jubla-Kinder und ‑Jugendliche. Eigentlich hätten es alle verdient, mitzufahren.» Man habe sich schliesslich auf einen Kompromiss von 35 Teilnehmenden geeinigt. Ausgewählt wurden für diesen prominenten Auftritt die Blauring- und Jungwacht-Scharen St. Gallen-Heiligkreuz. In Sachen Wagen wurde das OK in Andwil-Arnegg fündig: Die dortige Jungwacht gestaltet jeweils einen Fasnachtswagen und hat auch einige Umzugserfahrung. Ein paar Monate später ist das Projekt auf Kurs: Mehrere Jungwacht- und Blauring-Scharen sind beim Bau des Wagens, dem Bemalen der Raddeckel und dem Basteln der Dekoration beteiligt.

Lagerstimmung vermitteln
Die Jubla bringt Lagerstimmung an den Olma-Umzug: Auf ihrem Wagen wird ein echtes Lagerfeuer brennen. Zudem werden Jubla-Lieder zu hören sein. Das wird bei vielen Umzugsbesucherinnen und ‑besuchern eigene Lagererinnerungen wachrufen. «Hoffentlich macht es aber auch bei vielen Eltern und Kindern, die selbst noch nicht teilgenommen haben, Lust auf Jubla-Lager», so Andrea Zünd. Die Jubla wird mit ihrem Umzugswagen auch das aktuelle schweizweite Jubla-Jahresthema «Öko? Logisch!» sichtbar machen. «Das Thema Ökologie und Nachhaltigkeit ist in der Jubla schon lange ein wichtiges Anliegen. Wir achten zum Beispiel darauf, bei Gruppenstunden möglichst wenig Materialien einzusetzen, und viele Gruppenanlässe finden sowieso draussen in der Natur statt.»
«Wir machen sichtbar, wie wichtig und wertvoll die Kinder- und Jugendarbeit in der Kirche ist und dass unglaublich viel Freiwilligenarbeit geleistet wird.»
Andrea Zünd
Wichtiger Teil der Kirche
«Uf Bsuech dihei» lautet das diesjährige Olma-Motto – für einmal ist St. Gallen selbst der Gastkanton. Über 50 Gruppierungen mit rund 1300 Mitgliedern aus allen Regionen des Kantons werden am 12. Oktober am Umzug durch die St.Galler Altstadt mitwirken. Der Kanton St.Gallen hat dafür verschiedene Organisationen und Institutionen angefragt, die für den Kanton St. Gallen stehen, darunter auch die evangelisch-reformierte Kirche des Kantons St.Gallen und die katholische Kirche. Die Wahl der katholischen Kirche fiel auf die Jubla: «Die Jubla ist ein wichtiger Teil der Kirche», betont Andrea Zünd. «Wir machen sichtbar, wie wichtig und wertvoll die Kinder- und Jugendarbeit in der Kirche ist und dass unglaublich viel Freiwilligenarbeit geleistet wird. In den Jubla-Scharen werden christliche Werte wie Nächstenliebe, Respekt und Verantwortung gegenüber der Schöpfung gelebt und das alles sehr konkret und lebensnah.» Deshalb war sich das OK schnell einig, das Thema Nachhaltigkeit auch beim Olma-Wagen in den Fokus zu rücken.
Freiwilliges Engagement
Nur ein paar wenige Fragen sind noch offen. «Wir wollen an die Zuschauerinnen und Zuschauer beim Umzug etwas verteilen», sagt Andrea Zünd. Sie hätten mehrere Ideen, aber die definitive Entscheidung ist noch nicht gefallen. «Momentan sind wir noch in der Abklärung, wie gross unser Budget und die Beiträge vom katholischen Konfessionsteil des Kantons St.Gallen und der Stiftung der Jubla sind. Zudem sollten die Give-aways umweltfreundlich sein – also plastikfrei.» Das Projekt Jubla am Olma-Umzug wird vor allem durch freiwilliges Engagement der Jugendlichen und jungen Erwachsenen realisiert – und das nebst dem üblichen Jubla-Jahresprogramm, das mit vielen Anlässen in den Scharen vor Ort und überregional gefüllt ist.

Als Erwachsene ein Kind sein
Andrea Zünd sieht in der Teilnahme am Olma-Umzug die Chance, die Jubla bekannter zu machen: «Wir sind die grösste Kinder- und Jugendbewegung in der Ostschweiz. Trotzdem klickt es nicht gleich bei allen, wenn man sie mit dem Begriff Jubla konfrontiert.» Oft höre man dann: Ah, ihr seid wie die Pfadi? Andrea Zünd hofft, dass es in Zukunft heisst: «Ah klar, Jungwacht Blauring – kenn ich natürlich!» Sie ist sich sicher, dass auch für die mitwirkenden Kinder und Jugendlichen die Teilnahme am Umzug eine prägende Erfahrung sein wird. «Für einmal selbst beim Umzug mitfahren zu können, das ist ein Erlebnis, an das man sich ein Leben lang erinnert.» Andrea Zünd war 2003 zum ersten Mal mit dem Blauring Altstätten in einem Lager, seit 2010 ist sie Leiterin. Inzwischen wohnt sie in Widnau und ist studierte Sozialpädagogin. «Die Jubla-Erfahrungen haben sicherlich meine Berufswahl mitbeeinflusst.» Bis heute ist sie ein begeistertes «Blauring-Kind». «Wo sonst als bei der Jubla kannst du auch als Erwachsene nochmals Kind sein?»

Jubla in der Ostschweiz boomt
Trotz oder gerade wegen der Digitalisierung: Die Angebote der Jubla stossen in der Ostschweiz auf grosse Nachfrage. Vergleicht man die Mitgliederzahl von 2014 mit den aktuellen von 2024, so ist sie von 4445 Kindern und Leitungspersonen auf 4637 gewachsen – und der Zuwachs hält auch in diesem Jahr an. Hinzu kommen noch um die 110 Engagierte in Regionalleitungen, Kantonsleitung sowie Coaches und Kursleitende. Den Höchststand in den vergangenen zehn Jahren verzeichnete die Jubla Ost im Jahr 2020 mit 4953 Leitenden und Kindern.
Text: Stephan Sigg
Bilder: Ana Kontoulis / Claudio Bäggli
Veröffentlichung: 23.09.2024