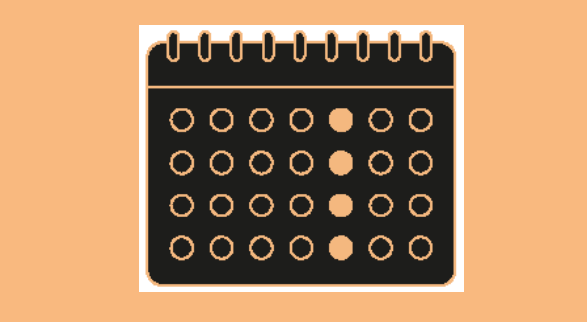Neue Wege zur Erstkommunion
Zahlreiche Kinder und Familien feiern in diesem Frühling Erstkommunion. Worauf freuen sie sich? Was bedeutet ihnen das Fest? Das Pfarreiforum hat den Eltern-Kind-Vorbereitungstag in Niederuzwil besucht und den neuen ausserschulischen Erstkommunionweg kennengelernt.
Es duftet nach frischgebackenem Brot. Im Eingangsbereich des Pfarreizentrums in Niederuzwil formt eine Gruppe Kinder weiteren Teig zu Brötchen. Später an diesem Eltern-Kind-Vorbereitungstag auf die Erstkommunion sollen diese an der Abschlussfeier geteilt werden. Mitten unter den Kindern arbeitet die Drittklässlerin Gloria. Ihre Mutter Sara steht neben dem Tisch. «Ich selber hatte meine Erstkommunion in Rorschach. Aber an eine so schöne Vorbereitung kann ich mich nicht erinnern. Mir fällt nur der Marsch ein, den wir Kinder an der Erstkommunion durch Rorschach machten», sagt die Katechetin in Ausbildung. Der neue Erstkommunionweg in Niederuzwil begleitet die Kinder hingegen während eines Jahres. Es gibt zehn Treffen, die unter anderem aus Gruppenstunden, Ausflügen, einer Tauferinnerung, dem Vorbereitungstag, Proben für die Erstkommunion und der Erstkommunion bestehen. «Die Kinder bekommen viel mit und erleben Schönes mit Gleichaltrigen», sagt Sara. Umso grösser sei die Freude in diesem Jahr, weil die Erstkommunion ihres älteren Kindes wegen Corona nicht in der Gemeinschaft gefeiert werden konnte. «Vor allem meine Mutter, also Glorias Grossmutter, in Spanien war sehr traurig. Sie konnte nur per Live-Stream dabei sein», sagt Sara. In diesem Jahr seien hingegen 25 Personen eingeladen. Nach der Feier zur Erstkommunion am 5. Mai gehe es ins Restaurant.











Dann ist es Zeit für Gloria, zum nächsten Posten im Pfarreizentrum zu gehen: Dort werden die Masse für das Blumenkränzchen und die Gewänder genommen. Die Primarschülerin freut sich auf die Erstkommunion. «Wir essen in einem Restaurant, in dem es gebackene Champignons gibt. Und ich werde unter meinem Gewand ein ganz besonderes Dirndel tragen, das aus Deutschland kommt», erzählt die 8‑Jährige. Am Erstkommunionweg habe ihr vor allem der Ausflug zur Hostienbäckerei gefallen. «Ausserdem haben wir vieles über den Ministrantendienst erfahren und gesehen, was die alles Spannendes machen.»
Ein Netzwerk für Familien
Den neuen Weg zur Erstkommunion gibt es in Niederuzwil erstmals seit diesem Schuljahr. Die Treffen finden alle ausserschulisch statt. Eingeführt wurde das, weil teils Kinder ökumenisch unterrichtet werden und somit nicht alle Kinder einer Religionsklasse für die Erstkommunion vorbereitet werden können. 25 Kinder sind es in Niederuzwil in diesem Jahr, die auf diese Weise die Vorbereitung zur Erstkommunion nutzen. «Das hat Vorteile. Als Gruppe haben wir alles dasselbe Ziel. Früher, im schulischen Religionsunterricht, waren hingegen immer Kinder mit dabei, die keine Erstkommunion hatten», sagt Manuela Trunz. Die Religionspädagogin ist in diesem Jahr für den Eltern-Kind-Vorbereitungstag zuständig, der in Niederuzwil seit über fünfzehn Jahren jeweils einige Wochen vor der Erstkommunion stattfindet. «In Niederuzwil hatten wir schon immer ein gutes Netzwerk und ein grosses Angebot für Familien», sagt sie und fügt an: «Dieses Mal sind wir vergleichsweise ein kleine Gruppe. In anderen Jahren haben auch schon um die 40 Kinder zusammen Erstkommunion gefeiert.»
Mühle, Technik und Mandalas
Rückmeldung zum neuen Weg zur Erstkommunion hat Manuela Trunz bislang nur positive erhalten. «Vor allem die drei Ausflüge, von denen sich die Kinder für einen anmelden mussten, haben allen gefallen», sagt sie. Der 9‑Jährige Joel beispielsweise hat gleich bei allen drei mitgemacht. Ausser zur Hostienbäckerei ging es zu einem Rebberg und in eine Mühle. «Die Mühle fand ich am spannendsten, weil ich Technik liebe», sagt er. Mit seiner Mutter Conny ist er beim Posten «Andenken gestalten» gerade damit beschäftigt, auf einem Holzbrett mit Nägeln und bunten Gummischnüren ein Mandala zu gestalten. «Jesus, meine Mitte»: Das Motto des Mandalas ist vorgegeben, bei der Umsetzung können die Kinder ihrer Kreativität allerdings freien Lauf lassen. «Die Vorbereitung auf die Erstkommunion ist toll und viel spannender als die Kirche», sagt er. «Dort muss man immer still sitzen und Kinder verstehen vielleicht nicht alles. Hier ist das anders.» Joels Mutter ist evangelisch-reformiert. Sie finde es schön, während dieses einen Jahres den Blickwinkel ihres Kindes einzunehmen, sagt sie. Welche Gedanken den Eltern im Hinblick auf die Erstkommunion durch den Kopf gehen, können sie beim Posten «Briefe für die Kinder» festhalten. In ruhiger Umgebung schreiben sie dort Wünsche und Hoffnungen für ihre Kinder auf. Die Briefe werden an der Feier im Mai übergeben.











Mit 60 Personen feiern
«Wunderschön finde ich all diese Vorbereitungen», sagt auch Matea, die zusammen mit ihrer Tochter Mia ein Glaskreuz gestaltet. An diesem Posten bekleben die Kinder Glas mit bunten Glasstücken, das später in einem Ofen gebrannt wird. «Das Basteln und die Erlebnisse mit meinen Freunden gefallen mir am besten», sagt Mia. Sie freue sich auf die Erstkommunion und auf das grosse Fest danach, zu dem 60 Personen eingeladen sind. Ihre Mutter Matea ergänzt: «Der Tag ist uns wichtig und wir wollen ihn mit allen in der Familie feiern.» Sie selbst hatte ihre Erstkommunion in Kroatien. «Vorbereitungen mit Basteln und all den anderen Dingen hatten wir allerdings nicht. Ich glaube, wir lernten vor allem Texte und Lieder», sagt sie.





Probeweise ministrieren
Was ist ein Tabernakel? Wie funktioniert ein Einzug in die Kirche? Welche Gewänder ziehen Ministranten an? Und wieso macht man eine Kniebeuge? In der Kirche gleich neben dem Pfarreizentrum ist es Zeit für den letzten Posten. Einige Ministrantinnen und der Seelsorger Paul Gremminger erklären den interessierten Primaschülerinnen und Primarschülern alles rund ums Ministrieren. Nach der Erstkommunion kann, wer möchte, Ministrantin oder Ministrant werden. Mit grossen Augen und in den Gewändern, die die Kinder versuchsweise anprobieren konnten, schauen sie sich in der Kirche um. Dort, im Kreis um den Alter herum, werden sie auch an der Erstkommunion stehen. Sie sind beeindruckt, gerade auch vom Tabernakel. Der 9‑Jährige Joel streckt seine Hand auf und sagt: «Dass die Hostien hinter so einer dicken Panzertür aufbewahrt werden, hätte ich nicht gedacht.»





Text: Nina Rudnicki
Bilder: Benjamin Manser
Veröffentlichung: 26. März 2024