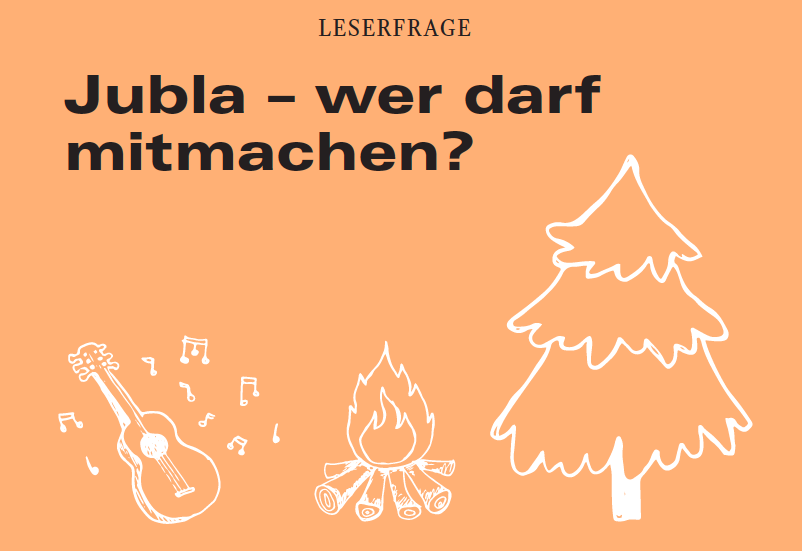26. Oktober 2022
Keine Kommentare
An verschiedenen Stationen müssen Alltagssituationen aus der Perspektive von Personen mit Demenz gemeistert werden. Ein Spielzeugauto über eine gezeichnete Strasse schieben. Doch das Bild ist spiegelverkehrt, jede Kurve wird zur Geduldsprobe. Diese und zwölf weitere Stationen des Demenzsimulators vermitteln eine Ahnung vom Alltag von Menschen, die an Demenz erkrankt sind.
Freitagnachmittag im reformierten Kirchgemeindehaus in Ganterschwil. Sieben Teilnehmerinnen des Kurses «Menschen mit Demenz begleiten» testen den «Demenzsimulator»: An einer Station gilt es, eine Schürze anzuziehen – aber mit übergrossen Handschuhen. Jeder Knopf ist eine Herausforderung. An einer anderen Station wartet ein Text. Doch er ist von so vielen Hieroglyphen verunstaltet, dass man ihn nur mit viel Konzentration lesen kann. Ich gebe mir Mühe, versuche mich zu konzentrieren, aber sehr schnell macht sich Ungeduld und Frustration breit. An anderen Stationen fühlt man sich hilflos oder verliert – weil es nicht so funktioniert wie gewünscht – das Interesse und die Lust. So geht es auch den anderen Teilnehmerinnen. Zwar wird ab und zu gelacht, doch die Betroffenheit ist deutlich spürbar: Was für uns nur ein Test ist, ist für Menschen, die an Demenz erkrankt sind, der Alltag.
Frustration und Scham
Welchen Hindernissen begegnen Demenzkranke in ihrem Alltag? Maya Hauri Thoma, bei der Evangelisch-refomierten Kirche des Kantons St. Gallen zuständig für die Projektstelle «Hochaltrigkeit und Demenz», hat den Demenzsimulator mit seinen 13 Stationen in Deutschland entdeckt und in die Schweiz geholt. Er kommt bei Kursen zum Einsatz, wird aber auch an Kirchgemeinden, Pfarreien und Bildungsinstitutionen ausgeliehen. Die Resonanz sei gross, in diesem Jahr war er in der ganzen Deutschschweiz unterwegs. Selbstverständlich: Der Simulator ist nur ein Versuch, Einblicke in das Erleben und Empfinden von Demenz-Erkrankten zu ermöglichen – wie es den Betroffenen wirklich geht, wissen nur sie. Maya Hauri Thoma weist auch darauf hin: «Es gibt nicht die Demenz. Jeder Demenzkranke ist anders.» Bei den Teilnehmerinnen in Ganterschwil löst der Simulator viel aus. «Man kann einfach nicht begreifen, dass etwas so einfaches und selbstverständliches nicht mehr geht», sagt eine, «man ist frustriert und schämt sich.» Alle von ihnen haben privat oder in ihrem freiwilligen Engagement schon mit Menschen, die an Demenz erkrankt sind, zu tun gehabt. Jemand erzählt von einem Demenz-Betroffenen, der plötzlich nicht mehr am Seniorenmittagstisch teilnahm, weil er mit Messer und Gabel überfordert war. «Sie schämen sich, auswärts zu essen und das vergrössert die Isolation noch mehr.»
Tipps für den Alltag
Der Demenzsimulator soll mehr als nur Betroffenheit auslösen: Er soll Verständnis wecken für die Gefühle und das Verhalten von Demenzkranken. Gleichzeitig soll er auch einen unverkrampften Umgang ermöglichen. Maya Hauri Thoma zeigt den Teilnehmerinnen konkrete Tipps für den Alltag auf: «Wenn ich weiss, dass ein Verwandter Mühe hat, mit Messer und Gabel zu essen, dann kann ich Apéro-Gebäck anbieten, das man mit der Hand essen kann.»
«Einen unverkrampfteren Umgang»
Ende November schliessen die Gossauer Pfarreien ihr Themenjahr zur Demenz ab. Was hat es ausgelöst?
Martin Rusch, Sie sind Seelsorger und Mitorganisator des Themenjahres. Warum haben Sie dieses angeboten?
Martin Rusch: Die Kirche hat eine Verantwortung für Demenzkranke und deren Umfeld. Neben den medizinischen und sozialen Angeboten leistet die Seelsorge einen wichtigen Beitrag. Wir wollen zeigen, dass wir für Betroffene und deren Angehörige da sind.
Wird es in Zukunft spezielle Angebote für Demenz-Erkrankte in den Gossauer Pfarreien geben?
Martin Rusch: Das war auch eine der Erkenntnisse in diesem Themenjahr. Ursprünglich haben wir mit dem Gedanken gespielt, Gottesdienste für Demenz-Erkrankte zu initiieren. Fachpersonen haben uns darauf hingewiesen, dass es für die Betroffenen wichtig sei, Gottesdienste in ihrer gewohnten Umgebung mit dem gewohnten Ablauf zu erleben. Deshalb wäre es gerade kontraproduktiv, etwas Neues zu entwickeln.
Welche Erkenntnisse nehmen Sie aus diesem Themenjahr mit?
Martin Rusch: Wir waren überrascht von der grossen Resonanz. Alle Anlässe sind auf grosses Echo gestossen, man hat gemerkt, wie sehr das Thema die Menschen beschäftigt. Mich haben die Inputs und Gespräche ermutigt, ein Stück offener und natürlicher mit Menschen, die an Demenz erkrankt sind, umzugehen. Eines der schönsten Erlebnisse war das Singen mit Demenz-Erkrankten. Der St. Galler «Chor für Demenzkranke» hat uns in Gossau besucht und mit Betroffenen aus unseren Pfarreien gesungen. Die Sängerinnen und Sänger haben mit grosser Hingabe mitgemacht.
→ Der Demenzsimulator ist vom 28. November bis 4. Dezember nochmals in Gossau (Gemeinschaftshaus Wittenwis) zu Gast. Infos: www.kathgossau.ch
Text: Stephan Sigg
Fotos: zVg.
Veröffentlichung: 26. Oktober 2022