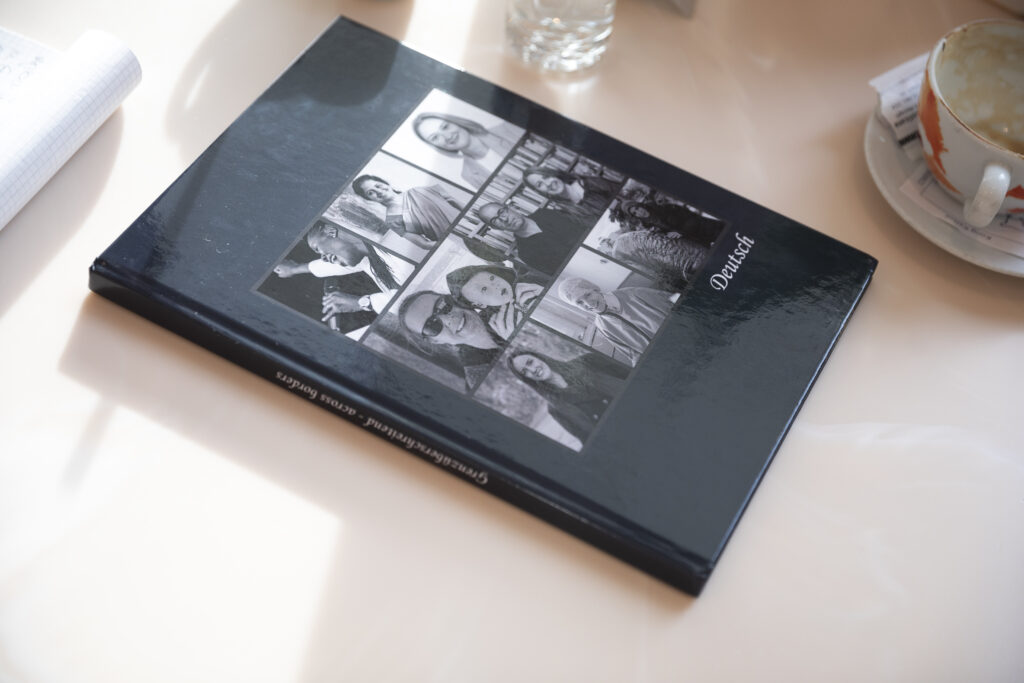«Wissen, dass immer jemand da ist»
Mirco Meier und Janina Landolt, kirchliche Jugendarbeiter in der Seelsorgeeinheit Gaster, unterstützen Jugendliche auf ihrem Weg ins Erwachsenenleben. Im Jugendtreff haben sie auch ein Ohr, wenn ein Teenager einmal einfach über sein Hobby sprechen will.
Zehn bis fünfzehn Jugendliche kommen jeden zweiten Samstagabend in den kirchlichen Jugendtreff in Weesen. Das Zusammensein geniessen, Musik hören oder miteinander Billard spielen. «Manchmal hat jemand auch das Bedürfnis, dass ihnen jemand zuhört», so Mirco Meier, Jugendarbeiter, «sie möchten mit einem Erwachsenen über das sprechen, das sie beschäftigt oder interessiert wie zum Beispiel ihr Hobby.» Ihm sei es wichtig, den Jugendlichen eine Erfahrung zu ermöglichen, die auch er als Jugendlicher erlebt hat: «In meiner Teenagerzeit zerbrach meine Familie, ich hatte in der Kirche Ansprechpersonen, die für mich da waren, das hat mich durch diese schwere Zeit getragen.»

Empathie trainieren
Gemütlich im Jugendtreff chillen und zusammensitzen, beim Koch-Abend «fair kochen» gemeinsam ein Rezept kreieren oder sich auf die Wallfahrt nach Einsiedeln begeben – in der Seelsorgeeinheit Gaster hat die kirchliche Jugendarbeit einen grossen Stellenwert. Für Mirco Meier ist Jugendarbeit nicht einfach ein «Nice to have», sondern theologisch begründet: «Es geht darum, Jugendliche zu unterstützen, freie und selbstständige Menschen zu werden.» Dies sei bereits bei der Synode 72 – eine Reformsynode der Schweizer Bistümer – so festgehalten worden. «Kirchliche Jugendarbeit ist viel mehr als einfach nur Freizeitbeschäftigung oder mit Gleichaltrigen beisammen sein: Jugendliche setzen sich bei unseren Angeboten auch ganz konkret mit Werten auseinander.» Er nennt als Beispiel das Angebot «fair kochen»: «Beim gemeinsamen Kochen werden auch Empathie und Toleranz trainiert. Die Teilnehmenden werden mit unterschiedlichen Geschmäckern, Vorlieben und Allergien konfrontiert und stehen vor der Herausforderung, ein Rezept zu entwickeln, das für alle passt. Beim Essen merken sie dann: Es schmeckt auch, wenn ich es nicht genau so mache, wie ich es immer mache.»
Jugendlabel lanciert
Zur kirchlichen Jugendarbeit gehört viel mehr als nur der kirchliche Jugendtreff: Ministranten-Arbeit, Jugendreisen … dazu kommen in vielen Seelsorgeeinheiten im Bistum St. Gallen auch verbandliche Jugendangebote wie zum Beispiel die Jubla oder die katholische Pfadi und Jugendpastoral wie der Firmweg oder Seelsorge. All diese Angebote sollen nun mehr ins Bewusstsein rücken und gewürdigt werden. Mirco Meier und Janina Landolt werten es als positives Zeichen, dass die Fachstelle für Jugendarbeit im Bistum St. Gallen (DAJU) nun ein «Jugendlabel» lanciert (siehe Kasten). «Ein solches Label hilft, die Angebote vor Ort genau anzuschauen und auch auf blinde Flecken aufmerksam zu werden», so Mirco Meier. Ein erster Schritt sei die Anstellung einer Jugendarbeiterin gewesen: «Die Jugendlichen sollen zwischen einer Frau und einem Mann als Ansprechperson wählen können.»

Persönlichkeit entwickeln
Wenn eine Kirchgemeinde in die Jugend investiert, investiert sie in die Zukunft, hört man oft als Argument für den Einsatz von kirchlichen Ressourcen für diese Zielgruppe. Mirco Meier sieht das etwas anders: «Der Grund für Jugendarbeit muss aus meiner Sicht sein, Jugendliche bei der Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen. Allein deshalb lohnt es sich, Ressourcen dafür zu investieren.» Es geht aber auch noch um einen anderen Aspekt: Kirchliche Jugendarbeit ermöglicht laut Mirco Meier Erlebnisse, zu denen manche Jugendliche aufgrund der finanziellen Situation zuhause keinen Zugang hätten. «Wir entlasten damit auch Familien, die von Armut betroffen sind: Einen Ausflug machen und dort etwas essen können, das ist nicht für alle eine Selbstverständlichkeit. Bei uns können alle mitmachen, niemand wird aufgrund seiner Situation zuhause ausgegrenzt.»

Erfahrungen machen
Janina Landolt beobachtet, dass sich Jugendliche heute nach Räumen sehnen, wo sie nicht bewertet werden und auch nicht schon wieder eine Leistung erbringen müssen. Dass manche Eltern ihre Kinder überhüten, sieht Mirco Meier kritisch: «Es gehört ja gerade zur Jugend, dass sie Erfahrungen machen können. Es ist eine herausfordernde Zeit, aber da lernen junge Menschen, auch mit negativen Erfahrungen umzugehen und daran zu wachsen. Wenn man erst mit 30 mit solchen Herausforderungen konfrontiert wird, hat man zuvor nicht die Chance gehabt zu lernen, damit umzugehen. Zudem erhält jemand in der Jugend häufig einfacher eine zweite Chance.» Der Jugendarbeiter steht auch im Austausch mit Eltern. «Wenn Jugendliche Probleme haben, wird das vielfach als Versagen der Eltern gedeutet. Viele sind deshalb total unter Druck. Dabei hat das oft nichts damit zu tun.» Für Janina Landolt ist das Vertrauen zwischen Eltern und Jugendlichen eine entscheidende Grundlage: «Das Wichtigste ist, zu vermitteln: Egal, was passiert, du kannst zu uns kommen und wir helfen dir. Und es gibt dann auch keine Vorwürfe oder Schuldzuweisungen. Jugendliche sollten wissen, dass immer jemand für sie da ist.»
Text: Stephan Sigg
Bilder: Ana Kontoulis
Veröffentlicht: 24. Mai 2024
Label für jugendfreundliche Kirche
Die DAJU und die Animationsstellen für kirchliche Jugendarbeit (akjs) haben ein Label für eine «jugendfreundliche Kirche» ausgearbeitet. Das Label soll eine öffentlich sichtbare Auszeichnung für eine qualitativ gute Jugendarbeit sein. Es werde für jeweils drei Jahre vergeben. Nach dieser Zeit kann es neu beantragt werden. «Das Label sei ein Zeichen für eine hohe Qualität und Professionalität der Jugendarbeit einer Seelsorgeeinheit», so die DAJU in einer Mitteilung. «Mit dem Label werden Seelsorgeeinheiten ausgezeichnet, welche die mit dem Label verbundenen zentralen Qualitätsmerkmale erfüllen.»
Das Label bringe der Seelsorgeeinheit und deren Jugendarbeit viele Vorteile. Unter anderem werden damit die Qualität und Professionalität der Jugendarbeit gestärkt und gegen aussen sichtbar gemacht. Die Ziele und Wirkung der Jugendarbeit werden definiert und auch überprüfbar. Zudem werden Seelsorgeeinheiten beim Aufbau und der Professionalisierung der Jugendarbeit unterstützt. Schliesslich könne damit das Vertrauen von Eltern und Familien in die Jugendarbeit gestärkt werden. Die Seelsorgeeinheit Gaster strebt als eine der ersten Seelsorgeeinheiten das Jugendlabel an.