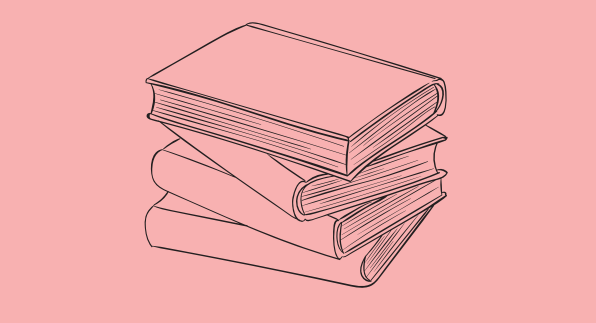«Jedes Engagement ist essenziell»
Die Hilfsorganisation Fastenaktion sieht die wachsende Armut und Hitzewellen als grosse Herausforderung. Am ersten Aktionsforum suchte unter anderem Lucrezia Meier-Schatz, ehemalige Nationalrätin aus St. Peterzell, Zukunftsstrategien.
Anfang November lud das Stiftungsforum des Hilfswerks Fastenaktion zum ersten Aktionsforum in Solothurn ein. Rund 60 Personen aus dem kirchennahen Umfeld haben daran teilgenommen. Sie haben Einblick in die Arbeit von Fastenaktion erhalten und über die aktuellen Herausforderungen gesprochen sowie mögliche Zukunftsstrategien konzipiert. «Das Forum war sehr erfolgreich. Es gab rege Diskussionen», sagt Lucrezia Meier-Schatz. Die ehemalige Nationalrätin und frühere Präsidentin der CVP/Die Mitte des Kantons St. Gallen ist seit 2006 Präsidentin des Stiftungsforums. Dieses ist zuständig für die Wahl der Stiftungsrätinnen und Stiftungsräte und die Evaluation der Kampagnen. Im Stiftungsforum sind zahlreiche katholische Organisationen vertreten. «Mit dem Aktionsforum wollen wir näher an die vielen Menschen, die sich an der Basis für Fastenaktion engagieren», so Meier-Schatz. Dabei geht es einerseits um die Wissensvermittlung, andererseits um den Austausch. «Das Aktionsforum soll unsere Botschafterinnen und Botschafter in ihrem Engagement in den Kirchgemeinden stärken. Sie sind unsere Multiplikatoren.»
Umkämpfter Spendenmarkt
Fastenaktion sieht sich seit Jahren mit dem Problem der weltweit steigenden Armut konfrontiert. «Die Spenden aus dem kirchlichen Umfeld reichen zur Finanzierung der Projektarbeit schon länger nicht mehr aus», sagt Lucrezia Meier-Schatz. «Einerseits spielt die Säkularisierung im Sinne des Religionsverlustes und andererseits die immer weiter schwindende Bedeutung der Religion für den spürbaren Spendenrückgang aus kirchlichen Kreisen eine Rolle.» Früher finanzierte Fastenaktion ihre Projektarbeit vor allem durch treue Spenderinnen und Spender. Älteren Generationen dürfte das blau-violette Spendensäckli von «Fastenopfer» noch in Erinnerung sein. Dies hat sich gemäss Lucrezia Meier-Schatz geändert. Heute habe sich das soziale Engagement von institutionsorientierten Spenden auf einzelne themenspezifische Projekte verschoben, erklärt Meier-Schatz. «Die jüngeren Generationen spenden meist für Einzelprojekte und wollen sich, wie in vielen Lebenslagen, nicht binden oder auf eine einzelne Organisation konzentrieren.» Lucrezia Meier-Schatz wertet diese Entwicklung nicht negativ, sondern spricht von einer legitimen Entscheidung und ist überzeugt: «Jedes gesellschaftliche und soziale Engagement ist essenziell.» Die Entwicklung erfordere von Fastenaktion allerdings ein Umdenken. «Wir müssen die jüngeren Menschen heute häufiger ausserhalb der kirchlichen Institutionen ansprechen und mehrgleisig fahren in der Kommunikation.»
In Bern lobbyieren
Als Bundesparlamentarierin war sich Lucrezia Meier-Schatz gewöhnt, ihre Meinung zu vertreten. Ihre politischen Erfahrungen setzt sie heute gezielt für Fastenaktion ein. Das Schlagwort hier lautet Lobbying. «Von den ständigen politischen Sparbemühungen des Parlaments sind wir direkt betroffen», sagt Lucrezia Meier-Schatz und spricht von einer riesigen Herausforderung. «Wir brauchen die Verbindungen ins Parlament, um den Schaden für uns so gering wie möglich zu halten.» Sorgen bereitet Lucrezia Meier-Schatz die Strategie Internationale Zusammenarbeit des Bundesrates. Dieser wird die Botschaft für die Jahre 2025 bis 2028 in den kommenden Monaten dem Parlament unterbreiten. «Er schlägt vor, dass ein substanzieller Teil der Gelder, 1,5 Milliarden Franken, also ganze 13 Prozent, die bis anhin für die Entwicklungshilfe im Süden reserviert waren, zugunsten der Ukraine reserviert werden. Für die ärmsten Länder ist dies verheerend, auch für unsere Programme, da weniger Geld von der DEZA (Anm. der Red.: Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit) zur Verfügung steht», erklärt Lucrezia Meier-Schatz und unterstreicht: «Gelder für die Unterstützung der Ukraine müssen gesprochen werden, dürfen aber nicht aus dem Topf, der für die Projekte der Internationalen Zusammenarbeit im Süden vorgesehen ist, entnommen werden.»
Einsatz nicht gefährden
In den kommenden Wochen wird Fastenaktion die Strategie für die Jahre 2024 bis 2028 festlegen. Die Länderprogramme, die systematisch evaluiert werden, sowie die Kampagnen stehen, angesichts der erwähnten Herausforderungen, im Fokus. «Wir müssen sicherstellen, dass wir mit unserem Engagement die Wirkung erreichen, die die Lebensqualität der Ärmsten nachhaltig verbessert, und wir weiterhin ein verlässlicher Partner für unsere Partnerorganisationen im Süden bleiben.» Auch die Suche nach neuen Partnerschaften wird die Verantwortlichen in Zukunft beschäftigen. Für Lucrezia Meier-Schatz ist klar: «Wir müssen wieder mehr die Gemeinschaft fördern in einer Zeit, in der der Individualismus Vorhand hat.» In den kommenden Jahren sollen wieder Aktionsforen stattfinden. Die Herausforderungen für Fastenaktion werden indes bleiben. Aber Lucrezia Meier-Schatz blickt positiv in die Zukunft. Sie weiss: «Die Spendenbereitschaft in der Schweiz ist nach wie vor gross und dafür sind wir dankbar.» Fastenaktion hat 2022 Spenden und Beiträge in Höhe von rund 24 Millionen Franken, davon 8 Millionen aus der öffentlichen Hand (u. a. DEZA), erhalten und in ihren 12 Länderprogrammen 338 Projekte unterstützt. Mit ihrem Engagement konnte sie die Lebensqualität von 2,5 Millionen Menschen erreichen, 58 Prozent waren Frauen.
Text: Alessia Pagani
Bild: Ana Kontoulis
Veröffentlichung: 10. Januar 2024