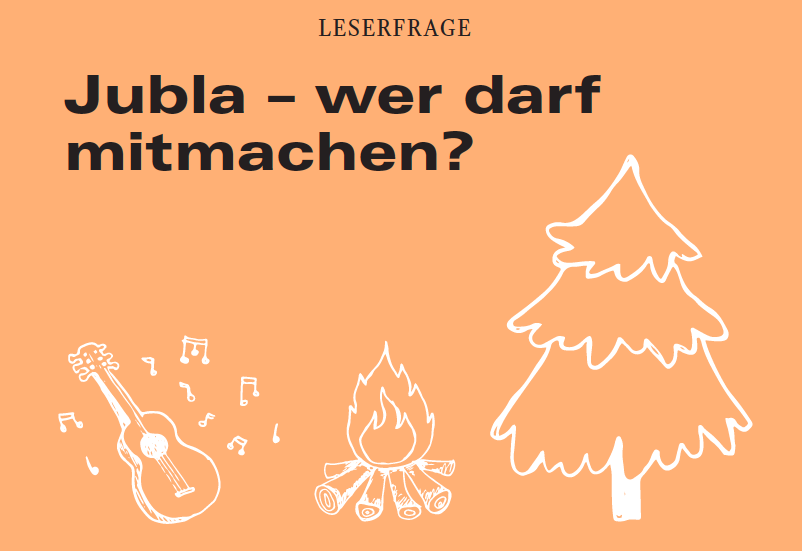Fokus auf Prävention
«Noch immer ist es für viele Missbrauchsbetroffene ein grosser Schritt, sich an das Fachgremium zu wenden und über das erfahrene Leid zu sprechen», sagt Daniela Sieber, Präsidentin des Fachgremiums gegen sexuelle Übergriffe im Bistum St. Gallen. Bischof Ivo Fürer hat das Gremium 2002 installiert.
Dieses Jahr jährte sich die Gründung des Fachgremiums zum zwanzigsten Mal. Als Bischof Ivo Fürer 2002 als Reaktion auf einen Missbrauchsfall das Gremium installierte, wurde noch kaum über sexuelle Missbräuche im kirchlichen Umfeld gesprochen. «In den vergangenen zwanzig Jahren hat sich extrem viel getan», fasst Daniela Sieber, Juristin und Mediatorin, zusammen. «Das Gremium hat sich konsequent weiterentwickelt und professionalisiert.» Das Fachgremium ist heute fest etabliert, in anderen Bistümern gibt es heute ähnliche Gremien und Anlaufstellen. Ging es anfangs vor allem um strafrechtliche Themen, habe sich der Fokus auf die Prävention verlagert. Ein wichtiger Schritt war 2016 die Einführung des Schutzkonzeptes im Bistum St. Gallen. Jährlich finden Einführungskurse für alle Angestellten und freiwillig Engagierte im Bistum statt. Das Thema ist auch fester Teil der Berufseinführung der Seelsorgenden. Seit 2017 können sich Betroffene von physischer und psychischer Gewalt, Mobbing, Arbeitsplatzkonflikten und emotionalen Grenzverletzungen auch an zwei Ombudspersonen wenden. Einen Beitrag zur Aufarbeitung leistet auch ein Genugtuungsfonds der Schweizer Bischofskonferenz. Dass ein Bewusstsein für die Not und die Erfahrungen der Betroffenen geschaffen wurde, dazu hätten auch die Medien beigetragen. «Und besonders all die Betroffenen, die ihre Erfahrungen öffentlich gemacht haben.»
«Dennoch gehen wir davon aus, dass es auch in unserem Bistum Betroffene gibt, die sich noch nicht gemeldet haben.»
Daniela Sieber
Hilfe bei Verarbeitung
Aktuell hat das Fachgremium keinen strafrechtlichen Fall zu bearbeiten. In diesem Jahr haben sich acht Personen gemeldet. Im Bistum St. Gallen sei es für Betroffene niederschwellig möglich, sich an das Fachgremium zu wenden. Sie behalten die Kontrolle über die Schritte und welche Informationen an welche Stelle gelangen. «Dennoch gehen wir davon aus, dass es auch in unserem Bistum Betroffene gibt, die sich noch nicht gemeldet haben», sagt Daniela Sieber. Deshalb sei das Gremium daran, sich immer wieder ins Gespräch zu bringen und auf sein Angebot aufmerksam zu machen. Für Theologin und Psychologin Regula Sarbach, Ansprechperson für Betroffene, kann es ein Beitrag zur Verarbeitung sein, wenn sich Betroffene auch Jahrzehnte nach dem Missbrauch melden: «Das Erzählen der Erfahrungen wird von vielen Betroffenen als wichtig und entlastend erlebt», sagt sie, «oft sind für die Betroffenen die Frage nach einer finanziellen Genugtuung oder strafrechtlichen Konsequenzen zweitrangig. Selbst wenn der Täter schon verstorben ist, kann es entlastend sein, Gehör zu finden.» Teilweise sind es auch Personen, die grenzverletzendes Verhalten beobachtet haben und sich melden.
Spiritueller Missbrauch
Relativ neu ist das Bewusstsein für den spirituellen Missbrauch. Dieser wurde vor allem durch das Buch «Spiritueller Missbrauch in der katholischen Kirche» der deutschen Theologin Doris Reisinger zum Thema: In vielen Gruppen und Gemeinschaften gibt es Personen, die leiten und Verantwortung tragen. Diese Personen haben Macht, die sie zum Guten einsetzen, aber auch missbrauchen können. «Solche Fälle sind oft nochmals viel komplexer als ein sexueller Übergriff und für die Betroffenen schwer zu erkennen und benennen», so Daniela Sieber. Um auch diese Betroffenen optimal begleiten zu können, könnte es laut Sieber sinnvoll sein, eine eigene Anlaufstelle zu schaffen.
Nichtkirchliche Meldestelle
In den letzten Jahren sind zahlreiche Bücher von Missbrauchsbetroffenen erschienen. Es gibt inzwischen auch Netzwerke und Gruppen, zu denen sich Betroffene zusammengeschlossen haben wie zum Beispiel die «Interessengemeinschaft für Missbrauchsbetroffene im kirchlichen Umfeld». Diese fordert die Errichtung einer gesamtschweizerischen, neutralen und unabhängigen Meldestelle. Daniela Sieber kann diese Forderung nachvollziehen: «Die Situation in den Bistümern ist bis heute ganz unterschiedlich. Im Bistum St. Gallen ist auch hier das Bewusstsein gewachsen. Heute ist im Fachgremium kein Mitglied mehr aus der Personalabteilung oder dem Ordinariat des Bistums vertreten.» Sieber sieht gespannt den Ergebnissen der historischen Studie zum sexuellen Missbrauch im Umfeld der römisch-katholischen Kirche entgegen, die die Schweizer Bischofskonferenz im Frühling in Auftrag gegeben hat. Diese soll einen weiteren Beitrag zur Aufarbeitung und Prävention leisten. Die Ergebnisse werden für Herbst 2023 erwartet.
Text: Stephan Sigg
Bild: zVg.
Weiterbildung für freiwillig Engagierte
Worauf müssen freiwillig Engagierte achten? Das Bistum St. Gallen bietet 2023 die Weiterbildung «Pfarreirat-Updates» zur Umsetzung des Schutzkonzeptes an. Pfarrei- und Pastoralräte haben, so die Ausschreibung, meist das ganze Spektrum der Freiwilligen in ihrer Pfarrei und Seelsorgeeinheit im Blick. Ihnen komme deshalb eine wichtige Rolle zu.
Samstag, 14. Januar 2023, Mels oder Samstag, 18. Februar 2023, Degersheim, jeweils 9 bis 12.45 Uhr
→ Informationen und Anmeldung: www.bistum-stgallen.ch