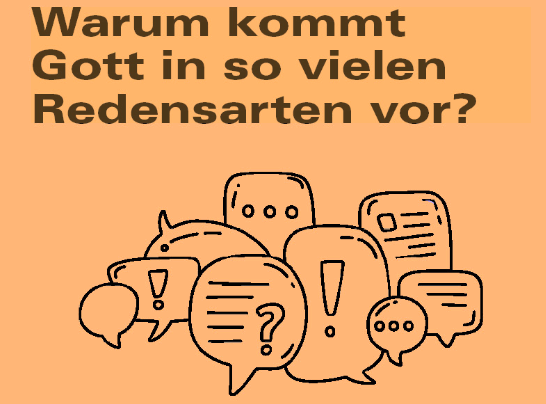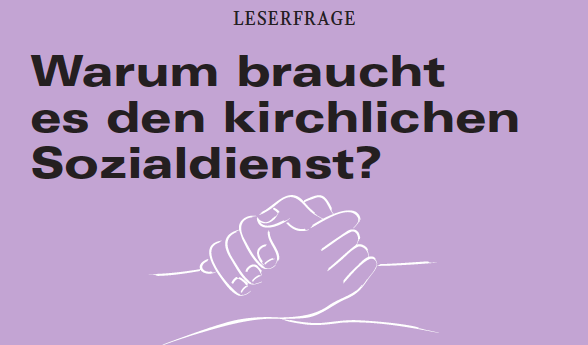Fake News oder Wahrheit
Eine eigene Reportage machen, einmal selber Fake News verbreiten sowie die Medienstadt St. Gallen entdecken: Das ermöglicht die neue Ausstellung im Kulturmuseum St. Gallen – und möchte dabei die Medienkompetenz der Besucherinnen und Besucher stärken.
Das Kloster St. Gallen, das Rathaus, die Stickereibörse, der Marktplatz, die Fürstabtei und das Homeoffice: Per Projektor erscheinen auf der Wand der «St. Galler Arena» im Kulturmuseum St. Gallen einstige und aktuelle Orte, die für die Medienstadt St. Gallen wichtig waren und sind. Durch Pilger, die ins Kloster kamen, gelangten etwa Neuigkeiten aus ganz Europa nach St. Gallen. Noch heute ist der Stiftsbezirk als Unesco-Welterbe Treffpunkt für Gläubige aus aller Welt. Die Stickereibörse um 1900 wurde auch als Schwatzbörse bezeichnet, da sie Raum für Klatsch und Stadtgespräche bot. Heute geht, wer sich informieren möchte, vielleicht in ein Café mit Zeitungsauswahl oder tut dies gleich von zu Hause aus via Homeoffice im Internet.
Rückzug in die St. Galler Arena
Nach einer Stunde Rundgang durch die neue Ausstellung «Auf der Suche nach der Wahrheit – Wir und der Journalismus» im Kulturmuseum ist die «St. Galler Arena» der ideale Ruheort, um sich das Gesehene noch einmal durch den Kopf gehen zu lassen und mit Eindrücken aus St. Gallen abzuschliessen. In dunkler, ruhiger Atmosphäre laden Stühle zum Hinsetzen ein. Bei einigen handelt es sich um sogenannte Ereignisstühle. Wer sich dort niederlässt, findet seitlich befestigte Tafeln, die jeweils eines von neun St. Galler Ereignissen aufgreifen. Dazu gehören etwa die Osterkrawalle 2021 in St. Gallen. Thematisiert wird, wie Social Media und Pandemie ineinandergriffen. Ein weiterer Ereignisstuhl erzählt die Geschichte der Kindsmörderin Frieda Keller, die Empörung über das Todesurteil sowie das Medienecho um 1900 zur sozialen Benachteiligung der Frau. Das frühste thematisierte Ereignis in der Medienstadt St. Gallen fand aber vor der Erfindung des Buchdrucks statt. Es ist das Schicksal der Stadtheiligen Wiborada, die eingeschlossen in eine Zelle als Inklusin lebte. 926 wurde sie bei einem Überfall der Ungarn auf die Stadt erschlagen. Die Menschen und die Schätze des Klosters konnten dank ihrer Warnung aber in Sicherheit gebracht werden. Ihre Geschichte ist handschriftlich festgehalten und beinhaltet wichtige Informationen zu jener Zeit.

Sich in Quellenkritik üben
Doch wieso sind diese St. Galler Ereignisse exemplarisch für die Mediengeschichte und die Ausstellung «Auf der Suche nach der Wahrheit – Wir und der Journalismus»? «Derzeit erleben wir die historische Veränderung im Journalismus sehr stark mit», sagte dazu Museumsdirektor Peter Fux an der Medienorientierung im März. Medienkompetenz und Quellenkritik würden immer wichtiger, um sich in der Flut aus Nachrichten zurechtzufinden. Genau dies sei das Ziel der Ausstellung: Sie soll aufzeigen, wie Medienschaffende arbeiten und die Besucherinnen und Besucher und gerade auch Jugendliche dafür sensibilisieren, wie und wo sie sich informieren und mit Informationen umgehen. Die Ausstellung funktioniert stark interaktiv. Die Besucherinnen und Besucher checken sich mittels Badge ein und schlüpfen während ihres Museumsaufenthalts in verschiedene Rollen. Im Burger-Spiel können sie beispielsweise Fake News verbreiten und versuchen, mittels übler Gerüchte ein Burger-Restaurant in den Ruin zu treiben. Je besser sie das tun, desto mehr Punkte gibt es. Eine weitere Station ist etwa der Newsroom. Dieser ist als Escape-Room gestaltet. Man lässt sich dort als Team einschliessen und kommt erst wieder frei, wenn man verschiedene Rätsel gelöst, eine journalistische Geschichte recherchiert und diese veröffentlicht hat. Das Spiel dauert rund 20 Minuten.

Die Wunderkammer entdecken
Ergänzt wird die Ausstellung durch verschiedene Medienereignisse wie das Frauenstimmrecht, die Pandemie und den Ukraine-Krieg. Zu sehen sind auch Interviews mit Journalistinnen und Journalisten, die über ihre Arbeit berichten. Spannend wird es zudem in der Wunderkammer. Dort sind verschiedene technische Entwicklungen zu sehen, von den ersten Tontafeln mit Keilschrift über alte Telefone, Kameras und Computer bis hin zu einem Tisch voller verschiedenster St. Galler Zeitungen, wie es sie um 1900 gab. Zum Schluss, beim Check-out nach dem Museumsbesuch, folgt eine Überraschung: Wer seinen Badge einwirft, bekommt einen Presseausweis ausgedruckt. Je nach Punktestand hat man den Status Praktikum, freie Mitarbeit, Redaktion oder Chefredaktion erreicht.
→ Infos zu Ausstellung und Rahmenprogramm: www.kulturmuseumsg.ch
Das Projekt hinter der Ausstellung: Hinter der Wanderausstellung «Auf der Suche nach der Wahrheit – Wir und der Journalismus» steht der Verein journalistory.ch. Dieser entstand 2017 durch das gleichnamige Oral-History-Projekt. Initiiert wurde es vom Westschweizer Filmemacher Frédéric Gonseth. Anlass der Vereinsgründung war die bevorstehende Abstimmung über die «No Billag»-Initiative. Diese wollte die Empfangsgebühr für Radio und Fernsehen abschaffen. → www.suchewahrheit.ch
Text: Nina Rudnicki
Bilder: Regina Kühne
Veröffentlichung: 30. März 2023