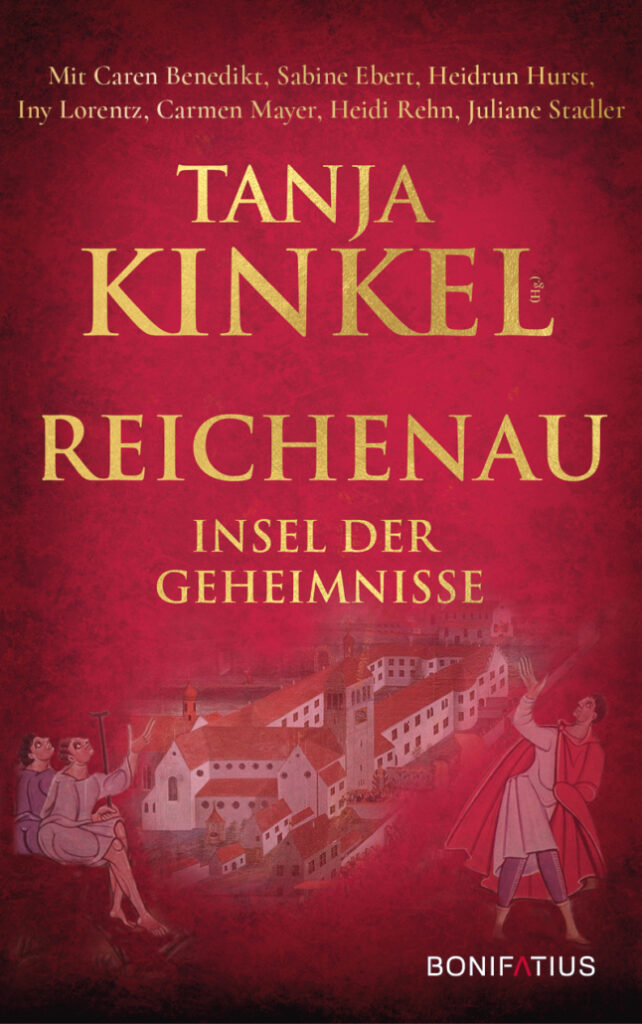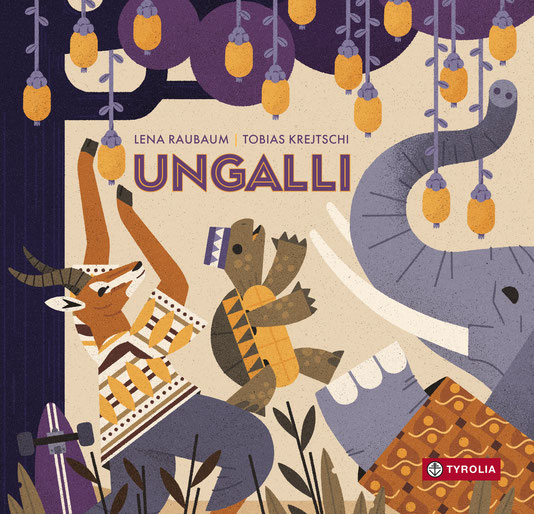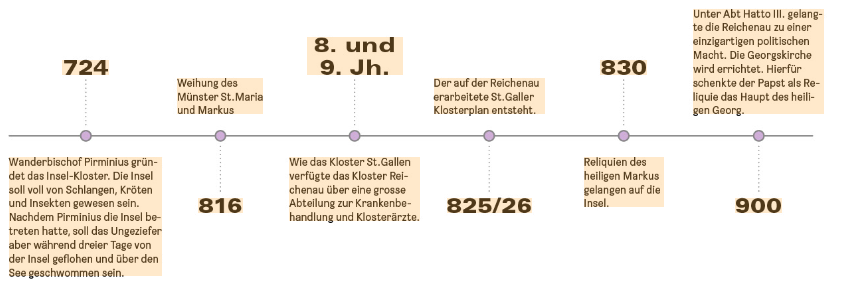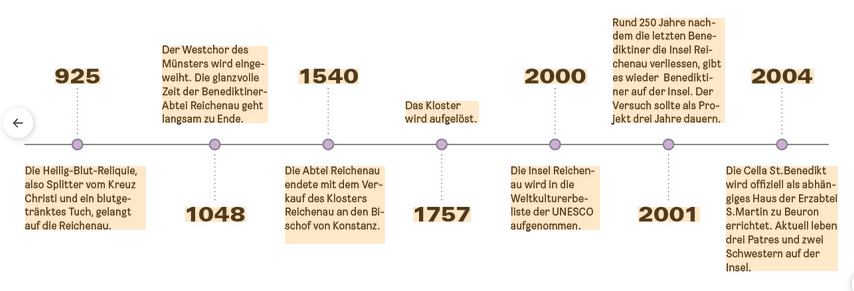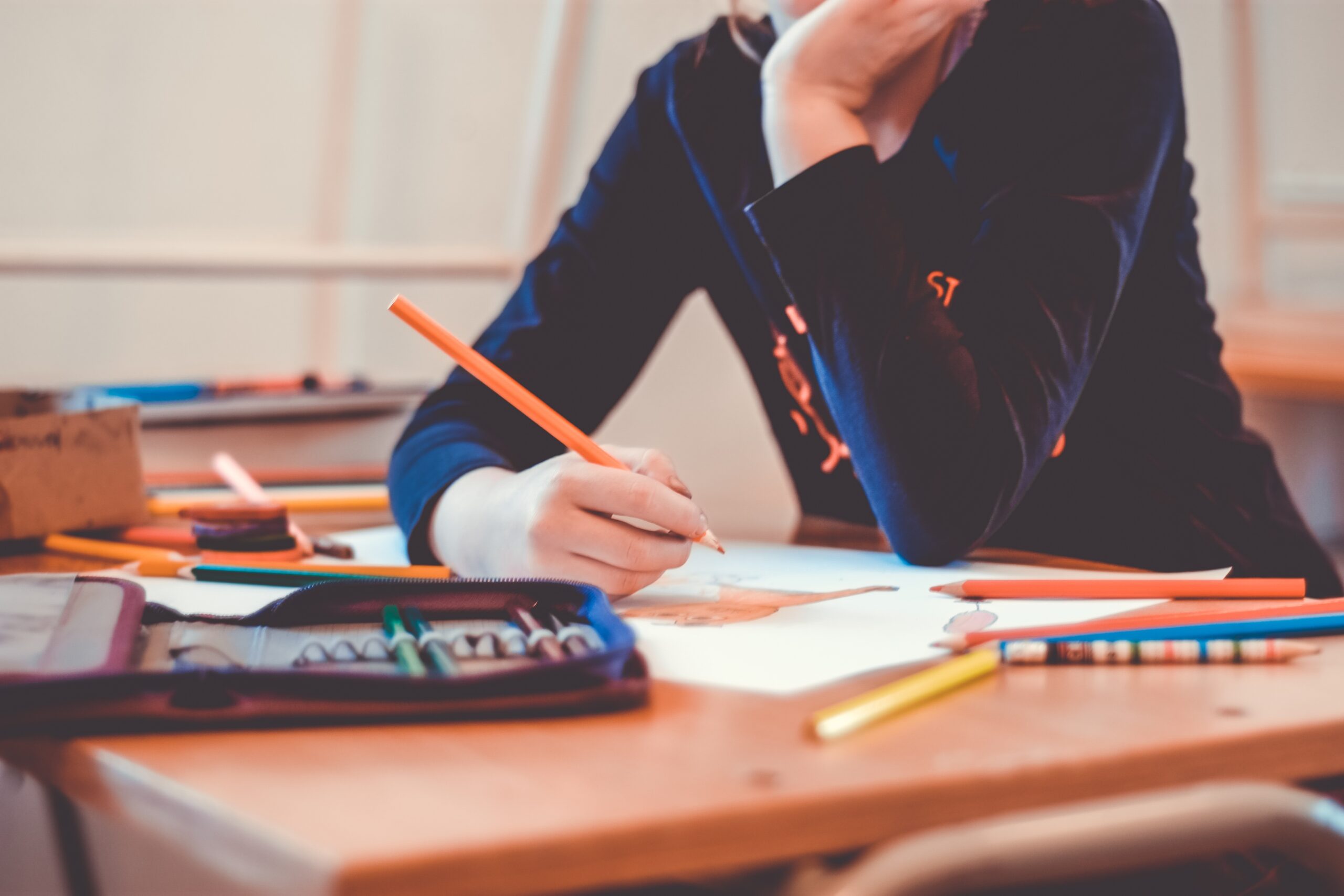«Die Komfortzone verlassen»
«Als ich eine neue Wohnung gesucht habe, habe ich visualisiert: Wie möchte ich wohnen? Wie sollte die Wohnung gelegen sein? Wie sollten die einzelnen Räume aussehen?», erinnert sich Aline Fischbacher und merkt schmunzelnd an: «Ich habe dann tatsächlich so eine Wohnung gefunden. Aber ich schreibe das jetzt nicht der Kraft der Manifestation zu, sondern der aktiven Auseinandersetzung mit meinen Wünschen und Bedürfnissen. Dabei ist mir klar geworden, was ich wirklich will, und das hat bei der Suche nach der passenden Wohnung geholfen.»
Aline Fischbacher kann nachvollziehen, warum das Manifestieren heute auf viele so faszinierend wirke. Und: «Gegen die Grundidee des Manifestierens ist nichts einzuwenden», sagt die St. Gallerin. «Gefährlich wird es hingegen, wenn Manifestieren mit einem Heilversprechen gleichgesetzt wird im Stil von: Du musst es dir nur ganz genau vorstellen, dann klappt es auch.»
Positive Vision als Antrieb
Aline Fischbacher ist als Coach, Supervisorin und Beraterin tätig. Sie unterstützt unter anderem Einzelpersonen sowohl im beruflichen Kontext als auch bei privaten Fragestellungen und bietet Supervisionen, Beratungen und Coachings für Organisationen an. «Egal, ob privat oder beruflich, es ist wichtig, sich Ziele zu setzen und sich aktiv damit auseinanderzusetzen, wohin man genau möchte.» So etwas inspiriere und helfe, einen Prozess in Gang zu setzen. «Sowohl als Einzelperson als auch als Team braucht man eine positive Vision. Ich erlebe immer wieder, wie dies Energie und Motivation in Gang setzt, sodass man auch Lust bekommt, dieses Ziel zu erreichen.» Gleichzeitig führe kein Weg daran vorbei, sich mit dem eigenen Beitrag auseinanderzusetzen: «Egal, um welche Veränderung es geht, es klappt nur, wenn ich bereit bin, die Komfortzone zu verlassen. Das kann Unterschiedliches bedeuten: Die Beziehungspflege spielt eine wichtige Rolle, also mein Umfeld aktivieren oder mein Netzwerk ausbauen, vielleicht muss ich mir neue Kompetenzen aneignen.» Gerade diese Aspekte blenden manche «Manifestationsgurus» aus. Wichtig sei auch, dass die Vision dynamisch bleibe: «Das Leben ist ein Prozess und deshalb gilt es auch, Visionen immer wieder zu hinterfragen und weiterzuentwickeln.» Sich auf eine bestimmte Vision zu fixieren, kann blockieren, es fehlt die Offenheit für andere Optionen. Sie spricht aus eigener Erfahrung: «Zuerst arbeitete ich bei der SBB, dann führte mich mein Weg zur Polizei, bis ich mich schliesslich selbstständig machte. Wenn ich mich von Anfang an total verbissen auf einen Traumjob fixiert hätte, wäre ich wahrscheinlich nicht dort, wo ich heute bin.»

Was will ich wirklich?
In ihrer beruflichen Tätigkeit hat Aline Fischbacher auch schon an einer Berufsschule Jugendliche gecoacht: «Einige nannten ‹Influencer› als Traumberuf. Im Gespräch stellte sich heraus, dass sie diesen Beruf so erstrebenswert finden, weil sie auf Instagram und Tiktok ständig mit Influencern konfrontiert werden. Das war für sie präsenter als die Frage: Was will ich persönlich wirklich? Was tut mir gut? Und wo liegen meine Stärken?» Gerade diese Fragen stehen bei der Positiven Psychologie im Fokus. Diese relativ junge Wissenschaft war auch Teil von Aline Fischbachers Ausbildung. Die Positive Psychologie wird oft fälschlicherweise mit dem positiven Denken verwechselt: «Die Positive Psychologie erforscht wissenschaftlich, was uns glücklich und zufrieden macht. Ein wesentlicher Anteil dabei ist die Auseinandersetzung sowohl mit den Stärken als auch mit den Schwächen. Sie zielt darauf ab, das Beste im Leben zu fördern, schlimme Erfahrungen und Erlebnisse zu überwinden und das Leben der Menschen lebenswerter zu machen.» Es gehe darum, den Blick nicht nach aussen, sondern nach innen zu richten und zu lernen, mit sich selbst zufrieden zu sein – eigentlich nichts Neues, das Christentum und viele andere Religionen lehren das seit Jahrtausenden. Gut möglich, dass gerade Social Media und die ständige Vergleichbarkeit – wer hat was, wer erlebt was – das Manifestieren gerade bei jungen Erwachsenen so populär gemacht haben.
Nicht bewerten
Menschen, die komplett in der Manifestations-ideologie gefangen sind, sind Aline Fischbacher in ihrem beruflichen und privaten Umfeld bis jetzt noch kaum begegnet. Aber was kann ich tun und sagen, wenn plötzlich meine beste Freundin vom Manifestieren als Allheilmittel überzeugt ist? «Das Wichtigste ist, nicht zu bewerten», ist die Supervisorin überzeugt, «man kann ja mal nachfragen: Warum ist dir das so wichtig? Was macht dich wirklich glücklich?» Sinnvoller als endlose Diskussionen zu führen, sei, etwas mit der Person zu unternehmen und sie zu Aktivitäten einzuladen. Das eröffnet für alle Beteiligten eine Perspektive. Denn die Positive Psychologie zeigt auch: Zufriedenheit finden die Menschen vor allem durch gelebte Beziehungen.
Text: Stephan Sigg
Bild: zVg
Veröffentlichung: 26.07.2024