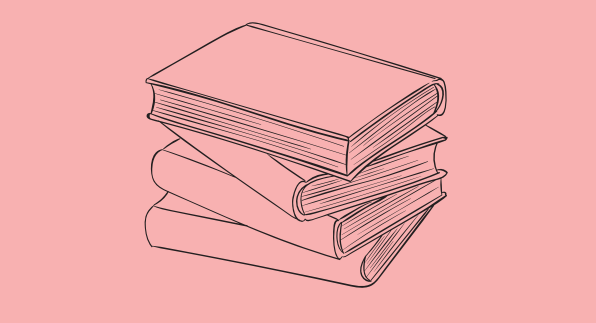Architektur und Musik als Lebenspfeiler
Auf einer Anhöhe bei Berg thront das Schloss Kleiner Hahnberg. Schlossherr ist Architekt Robert Bamert. Er hat in seinem Leben zahlreiche öffentliche Projekte realisiert – etwa den Umbau und die Restaurierung der Tonhalle St. Gallen.
Dreimal an der Türe zum Schlossturm klopfen, so lautete die Vorgabe. Gesagt, getan, und schon führt uns Robert Bamert durch die stattlichen Räume des Schlosses Kleiner Hahnberg bei Berg. Seit fast 50 Jahren bewohnt er das 500-jährige Haus, das er über viele Jahre restauriert hat, um die Spuren der Geschichte ans Licht zu bringen. Robert Bamert ist 84 Jahre alt und Architekt. Zu seinen renommiertesten Neubauten zählen die ETH-Lausanne aus den 70er-Jahren, die Siedlung Wolfganghof im Westen St. Gallens und das Schulheim für schwerbehinderte Kinder in Kronbühl. Er verantwortete unter anderem die Renovation des St. Galler Bahnhofs und der Tonhalle oder der Kunsthalle Ziegelhütte Appenzell sowie zahlreiche Kirchenrestaurierungen, etwa der katholischen Andreas-Kirche Gossau und der Klosterkirche Fischingen.
«Architektur, die Schwester der Musik»
Die Architektur ist nicht Robert Bamerts einzige Leidenschaft. Die zweite gehört seit über 70 Jahren der Musik. Jeden Morgen setzt er sich an eines seiner Tasteninstrumente, etwa an seine Mathis-Orgel im Erdgeschoss des Schlosses. Er ist überzeugt: «Man beginnt den Tag einfach anders – ruhiger, harmonischer.» Wenn Robert Bamert über die Musik spricht, beginnen seine Augen zu leuchten. Begonnen hat alles in der 6. Klasse mit dem Bau einer Geige. «Sie war eckig, aber hat geklungen.» Zu dieser Zeit begann er auch Gottesdienste in der Kathedrale zu besuchen. «Ich war fasziniert vom Raum, den Figuren, Bildern und der Dom-Musik von Orgel und Chor.» Diese Besuche und der St. Galler Klosterplan prägten Robert Bamert derart, dass er sich schliesslich für das Architekturstudium entschied. Die Beziehung zur Kathedrale St. Gallen besteht bis heute. Während 20 Jahren amtete er dort als Organisten-Aushilfe. Mit 77 Jahren verabschiedete er sich mit der dorischen Toccata von J. S. Bach. Die Musik nennt Bamert – nebst der Architektur – seinen Lebenspfeiler. Mit 65 Jahren hat er sich seinen Traum erfüllt und das Studium der Musikwissenschaft aufgenommen. «Dabei durfte ich lernen, wie bedeutend das Kloster St. Gallen für die früheste Entwicklung der abendländischen Musik war.» Die Architektur bezeichnet Robert Bamert als «Schwester der Musik». Er spricht von harmonikalen Proportionen: «Wenn etwas harmoniert, ist es schön – sowohl in der Musik als auch in der Architektur.»
Für mehrere Generationen denken
Die Faszination, einen Klangkörper zu schaffen, hat Robert Bamert nicht mehr losgelassen. Im Laufe der Jahre hat er mehrere Tasten-Instrumente nach historischen Vorbildern gebaut. Vor über 14 Jahren hat er mit dem Bau von zwei Orgeln begonnen – einer Spanischen und einer Italienischen. Vor wenigen Wochen ist er damit fertig geworden. Demnächst sollen sie ihren Platz im Konzertraum im Erdgeschoss des Schlosses einnehmen, und Robert Bamert hat bereits das nächste Projekt geplant: Ein Astrolabium am Schlossturm, ein Uhrwerk, mit dem man Veränderungen am Himmel nachbilden kann. Seit 30 Jahren treibt ihn diese Idee um. Gleich wie beim Instrumentenbau hat er sich dafür in spezifische Literatur vertieft. Stillstehen ist für den kinderlosen Senior keine Option. Warum er das alles macht im hohen Alter, ist man gewillt zu fragen. Robert Bamert überlegt keine Sekunde. «Gut gebaute Instrumente können bis 300 Jahre alt werden und bleiben für die nächsten Generationen erhalten und spielbar.» Er lässt den Blick über den Park und sein Schloss gleiten. «Etwas zu schaffen, das Generationen überdauert, macht Sinn und Freude.»
Text: Alessia Pagani
Bild: Ana Kontoulis