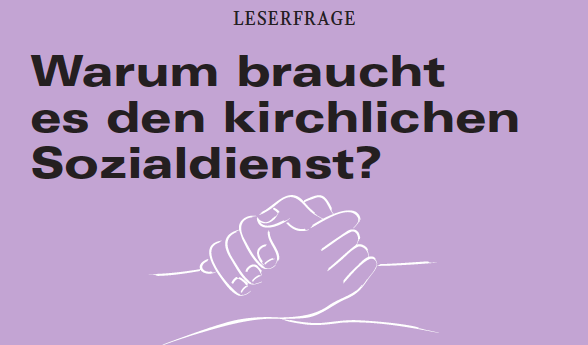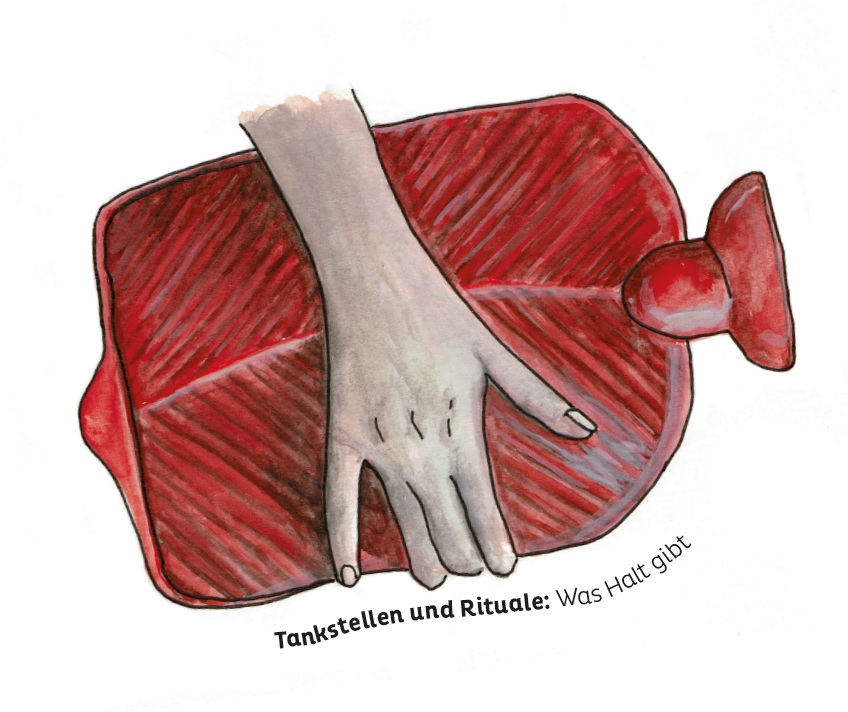25. Januar 2023
Keine Kommentare
Was hält Paare zusammen? Wieso trennen sie sich? Und wie schafft man es, dass Alltägliches seinen Zauber behält? Das Projekt paargeschichten.ch sammelt Erzählungen von Paaren.
Meine Momo
«Wenn Momo zuhörte, blühte die Fantasie der Erzählenden auf wie eine Frühlingswiese. Die Gedanken, die bisher zu Fuss gegangen sind, bekamen plötzlich Flügel», heisst es im gleichnamigen Buch von Michael Ende. Ich habe das Privileg, Momo bei mir zu Hause zu haben: Sie schlummert zwischen zwei Buchdeckeln, bis ich sie zum Leben erwecke; oder sitzt mir am Küchentisch gegenüber. Meine Momo ist meine Frau. Wenn ich ihr eine vage Idee erzähle, entwickelt sich diese wie von selbst weiter, allein durch ihre Art des Zuhörens. Sie ergänzt einen Gedanken, trifft mit einer Frage ins Schwarze oder hört einfach zu, mit den Augen.
Dort, in Rapperswil
Zwanzig Jahre, nachdem er sich von mir getrennt hat, ruft er an – nach zwanzig Jahren totaler Funkstille ruft er einfach unvermittelt an. Er sagt, dass er keine Angst vor der Angst mehr habe und dass er daher diesen Anruf gewagt habe. Ich falle, wie man sagt, aus allen Wolken, freue mich sehr. Und wir machen ein Treffen ab. In Rapperswil. Dort gehen wir dann zusammen über den Seesteg. Er erzählt mir, dass er einen Herzinfarkt hatte. Und dass dieser ihn gelehrt habe, mehr auf sein Herz zu hören. Er wolle lernen zu lieben. Nach zweihundert Metern auf dem Seesteg sind wir wieder total verliebt.
Leidenschaft statt Partnerschaft
Geniesse ich Spargeln, tunke ich das Köpfchen in die Sauce, sauge es aus – den Rest werfe ich weg. Es könnte bitter sein, holzig oder schlecht geschält. Und genauso halte ich es mit der Paarbeziehung: Endlos spiele ich den Akt des Sich-Verliebens, endlos beschäftige ich mich mit Ouvertüren, mit dem ersten Blick, der ersten Berührung, dem ersten Kuss, der ersten Vereinigung. Wird es aber ernst und kommen Paarbeziehungs-Gefühle auf, habe ich Angst, es könnte, wie die Spargeln, bitter werden, holzig. Und ich breche ab. Auf der einen Seite, ja, sehne ich mich so sehr nach Zweisamkeit, auf der anderen Seite gerate ich dermassen in Panik, sie in einer Partnerschaft zu fixieren – zu monogamisieren, alles auf eine Karte zu setzen. Wieso kapituliere ich vor der Paarbeziehung, wo ich doch den Grossteil meines Lebens in genau dieser Form von Beziehung gelebt habe? Oder ist es umgekehrt? Habe ich für mich gemerkt, dass die Paarbeziehung selber die Kapitulation ist? Die Kapitulation vor der Leidenschaft, vor dem ewig Neuen?
Die Bettflasche
In den dreizehn Jahren, in denen ich Flora kenne, gab es vielleicht fünf Abende, an denen ich vor ihr ins Bett gegangen bin. Sie geht früh ins Bett, manchmal schon vor 21 Uhr. Sie liebt ihr Bett. Und wenn sie einmal drin ist, ist sie die Königin. Doch wenn ich spät von der Arbeit komme, Zeit mit ihr verbringen will, ist Flora schon auf dem Rückzug. Dieser allabendliche Moment der Trennung fühlte sich für mich viele Jahre lang wie eine Niederlage an. Auch Flora litt unter meiner Enttäuschung. Bis zu dem Tag, vielleicht vor fünf Jahren, als Flora mich bat, ihr eine Bettflasche zu machen. Ich erhitzte sie – und brachte sie ihr ins Zimmer. Anfangs mochte ich das nicht unbedingt. Doch indem sie mich fragt, ob ich ihr die Bettflasche mache, teilt sie mir mit, habe ich mit der Zeit verstanden, dass sie ins Bett geht. Und seit ich das verstanden habe, tue ich das fast jeden Abend für sie. Es ist zu unserem gemeinsamen Ritual des Zubettgehens geworden. Ich bringe die Wärmeflasche herein und lege mich zu Flora, plaudere mit ihr und lasse den Tag gemeinsam mit ihr ausklingen. In manchen Nächten muss ich ihr manchmal, wenn ich mit der Bettflasche ins Schlafzimmer komme, ihren Kopf freilegen, um sie küssen zu können, so fest ist sie in ihre Decke eingewickelt. In diesen Nächten grummelt sie nur; kein «Gute Nacht», kein Kuss, keine Aufmerksamkeit. Aber ich weiss selbst dann, dass wir zusammen sind. Anspruchslos und wohlig verlasse ich das Schlafzimmer. Wenn mich Flora fragt, ob ich ihr ihre Bettflasche gemacht habe, fragt sie mich: «Teilen wir diesen Abend?» Sie fragt mich auch: «Gefällt es dir, dein Leben mit mir zu verbringen?» Und: «Weisst du, wie froh ich bin, dass du hier bist?» Ja, habe ich, Flora. Ja, das tun wir. Ja, sehr. «Ja, ich weiss.»
Der Besserwisser
Bei jeder Gelegenheit zückte er sein Handy, um zu googeln, ob nun Selma oder er recht hatte. Immer schon hat sie das genervt. Doch dann kam: Sizilien. Sie hatten eine Ferienwohnung in einem kleinen mittelalterlichen Städtchen und sassen auf der Piazza beim Nachtessen, gleich gegenüber einer Kirche. Über der Eingangstür stand in tiefroten Lettern «Chiesa del Purgatorio» – und Willy fragte sie, was wohl «Purgatorio» bedeute. Ohne zu überlegen, sagte sie es ihm: «Fegefeuer!» Wieso sie das nun wieder wisse, sagt er, und: «Wenn du solche Sachen weisst, ist es klar, dass bei dir dafür andere Hirnareale unterentwickelt sind!» Sie wollte etwas entgegnen, konnte aber nicht, es ging nicht mehr, wortlos stand sie auf, warf die Serviette auf den halb leergegessenen Teller mit dem Riso ai Frutti di Mare, ging in die Ferienwohnung zurück, packte ihren Koffer und fuhr zum Flughafen. Zuhause löschte sie seine fünfzehn Anrufe in Abwesenheit und achtzehn SMS. Und blockierte seine Nummer.
Vor dem Velokurierladen
Ein paar Tage nachdem ich von einer langen Pilgerreise nach Santiago zurückkam, stand ich in meinem Velokuriergeschäft, als zwei Frauen hereinkamen. Sie fragten mich, ob sie ihre Veloreifen pumpen könnten. Und so kamen sie ins Gespräch mit mir und den anderen Velokurierfahrerinnen und ‑fahrern, die noch im Laden herumstanden oder am Ende ihrer Schicht etwas zusammen trinken wollten. Wir hatten eine gute Zeit, und als sich die muntere Gesellschaft aufzulösen begann, war es Abend geworden. Meine Geschäftspartner, die eine Frau und ich blieben etwas länger. Als wir die Tür abschlossen, kam er, dieser eine Moment, der mein Leben verändern sollte: Mein Heimweg führte mich in dieselbe Richtung, die auch mein Geschäftspartner einschlug. Doch der Weg der Frau ging in die entgegengesetzte Richtung. Ich stand unentschlossen da. Die Frau auch. Mein Geschäftspartner rief: «Kommst du …?» Ich aber bewegte mich nicht. Bis sie schliesslich zu mir sagte: «Küss mich, aber richtig!» Und so habe ich sie geküsst, an jenem Abend vor 22 Jahren. Heute sind wir Eltern von drei Kindern.
Texte: paargeschichten.ch
Illustrationen: Lea Neuenschwander
Veröffentlicht: 25.01.2023