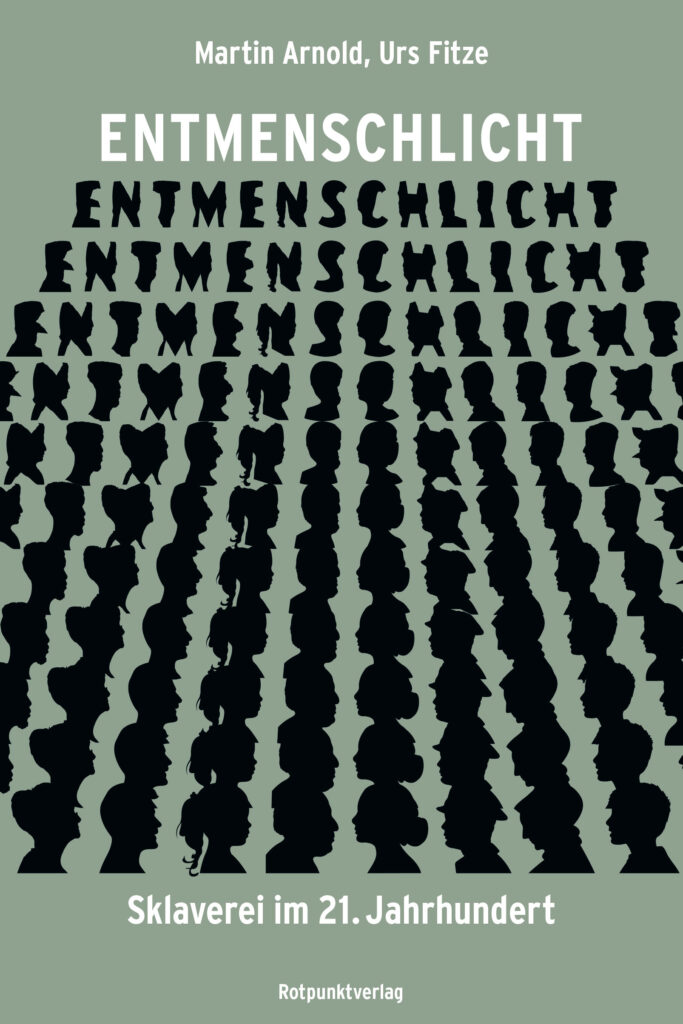Als Pilgerinnen Neues in Altbekanntem entdecken
Flache Strecken können anstrengender sein als hügelige. Und während des Gehens lassen sich besonders gut neue Bekanntschaften knüpfen: Diese Erfahrungen haben Tosca Wetzel und Nadia Maciariello aus St. Gallen auf ihrer ersten Pilgerreise gemacht. Zusammen mit 200 anderen Personen haben sie beim Bistumspilgern mitgemacht.
Jetzt sehe ich sie dann alle nicht mehr.» Dieser Gedanke ging Tosca Wetzel nach drei Tagen, in denen sie zu Fuss unterwegs gewesen war, durch den Kopf. Zusammen mit über 200 Personen hatte sie beim Bistumspilgern (siehe Info unten) mitgemacht und war von St. Gallen nach Magdenau, von Niederuzwil nach Dreibrunnen und von Bazenheid nach Libingen gepilgert. «Diese kurze Zeit hat ausgereicht, uns als Gruppe zusammenzuschweissen», sagt sie. Unterwegs begleitet wurde sie von ihrer Schwester Nadia Maciariello.
«Während des Pilgerns wird das Kleine gross und alle Sinne sind geschärft.»
Zusammen sitzen die beiden St. Gallerinnen nun am heimischen Küchentisch. Sie sprechen darüber, was Pilgern ausmacht und wie es ist, in Altbekanntem Neues zu entdecken. Die Idee, sich darauf einzulassen, hatte Nadia Maciariello. Über einen Bekannten hatte sie vom Bistumspilgern erfahren. Er sagte ihnen auch, dass noch Personen gesucht wurden, die mithelfen und unterwegs verschiedene Aufgaben übernehmen würden wie etwa Strassen sichern oder das Schlusslicht bilden. «Da wir beide noch nie gepilgert sind, das aber schon seit längerem einmal ausprobieren wollten, haben wir uns angemeldet», sagt Nadia Maciariello.

Dass flache, monotone Strecken anstrengender sein können als hügelige Etappen: Das ist eine Erfahrung, die Tosca Wetzel und Nadia Maciariello während des Pilgerns gemacht haben. «Auch die Offenheit der Teilnehmenden hat mich überrascht. Ich bin immer mit jemandem ins Gespräch gekommen und habe interessante Lebensgeschichten erfahren», sagt Tosca Wetzel. Nadia Maciariello ergänzt: «Es ist gut möglich, dass das Gehen ein Redebedürfnis auslöst oder dass wir nach der langen Coronazeit einfach Lust auf neue Kontakte haben. Und dann ist da sicher noch das Zusammengehörigkeitsgefühl der Pilgergemeinschaft, dass einen offener werden lässt.» Berührend habe sie es auch gefunden, dass in einer Pilgergruppe alle Personen unabhängig von Herkunft, Alter oder sozialem Hintergrund gleich seien. Familien mit Kindern und Seniorinnen und Senioren, Promis und Normalos, Betgruppen und nicht religiöse Personen seien zu Weggefährtinnen und Weggefährten geworden. «Unser Vater, der ebenfalls mitgekommen ist, entdeckte unter den Pilgernden eine bekannte Person aus der Medienwelt und fand das bemerkenswert» sagt Nadia Maciariello. «Aber nach einer Weile war es dann eben einfach nicht mehr so wichtig, mit wem man unterwegs war.»
Während des Pilgerns werde das Kleine gross, sagt Nadia Maciariello. Und Tosca Wetzel fügt an: «Definitiv. Ausserdem sind alle Sinne geschärft.» Als Beispiele nennt sie das Farbenspiel in den Kirchen oder all jene Ortschaften entlang der Route, die man sonst kaum besuchen würde, in denen es aber viele Besonderheiten zu entdecken gebe. Für beide ist klar: Wandern und Pilgern unterscheidet sich vor allem durch das Spirituelle, das ein wesentlicher Bestandteil vom Pilgern sei. Beim Bistumspilgern sind es etwa der besinnliche Einstieg in den Tag und der Abschied am Tagesende sowie eine Stunde täglich, in der die gesamte Gruppe schweigend pilgert.
«Ohne Erwartungen sein und sich überraschen lassen, das ist es, was Losgehen und unterwegs sein ausmacht.»
Die beiden Mitte 40-Jährigen sind sich einig, dass sie sich auch in Zukunft gerne im Pilgern versuchen möchten, dann aber vielleicht in einer kleineren Gruppe und auf einem längeren Wegstück. Im Wandern hingegen sind sie erfahren. Ob mit ihren Familien, als Lehrerinnen in der St. Galler Primarschule Boppartshof oder früher mit Jungwacht-Blauring: «Es ist etwas, das wir immer gerne und regelmässig gemacht haben» sagen sie.
Gastfreundschaft überrascht
Mit Wanderstöcken, gutem Schuhwerk und vor allem mit einem mit Verpflegung gefüllten Rucksack haben sich Tosca Wetzel und Nadia Maciariello daher auch auf die Bistumspilgerreise begeben. Zwar wussten sie, dass das Bistumspilgern durch die 33 Seelsorgeeinheiten führt. Nicht erwartet hätten sie aber die Gastfreundschaft, Freude und das Glockengeläut, mit denen sie dort jeweils empfangen worden seien. «Zum Teil gab es Musik und Gesang oder einen kleinen Imbiss wie etwa eine Suppe vom Feuer», sagt Tosca Wetzel. Und Nadia Maciariello fügt an: «Ohne Erwartungen sein und sich einfach überraschen lassen, das ist es, was Losgehen und unterwegs sein für mich ausmacht.» (nar)

Info: Das Bistum pilgernd kennenlernen
Spiralförmig geht es derzeit in 17,5 Tagen durchs Bistum St. Gallen: So viele Tage braucht es, um alle 33 Seelsorgeeinheiten pilgernd zu durchqueren oder zu streifen. Anlass dafür ist das 175-Jahr-Jubiläum des Bistums. Über 200 Personen waren es, die beim Start der Aktion Mitte März von St. Gallen über Herisau nach Magdenau pilgerten. Im April ging es unter anderem von Wattwil nach St. Gallenkappel. Von Juni bis September stehen weitere Etappen wie etwa von Buchs nach Salez oder von Speicher nach Rehetobel an. Interessierte können sich für eine oder gleich mehrere Routen anmelden. «Die Idee des Bistumspilgerns ist, dass man auf Etappen in jenen Gegenden mitpilgert, die man nicht gut kennt oder die man neu entdecken möchte», sagt Ines Schaberger, Geschäftsführerin des Bistumsjubiläums. «Auf diese Weise können wir unsere eigene Heimat neu kennenlernen und im scheinbar Unscheinbaren das Besondere entdecken.»
Dass diese Idee gut ankommt, zeigen die Rückmeldungen: Den Teilnehmenden gefalle, dass nicht die grossen Pilgerstätten Ziel der Reise sind, sondern ganz normale Orte zu Pilgerstätten werden. «Ausserdem ist es ein schöner Prozess, gemeinsam mit verschiedensten Menschen unterwegs zu sein», sagt sie. Der Altersunterschied zwischen der jüngsten und der ältesten Person habe zuletzt 75 Jahre betragen. Auch hat sich das Bistumspilgern laut Ines Schaberger beinahe schon zu einer Degustationstour entwickelt. Viele Seelsorgeeinheiten erwarteten die Pilgerinnen und Pilger mit Suppen, Kuchen und Kaffee. «Es gibt also genug Möglichkeiten, neue Bekanntschaften zu schliessen», sagt sie. Aber abgesehen davon ermögliche das Bistumspilgern vor allem schöne Erfahrungen in der Natur – ein Ort, an dem Gottes Schönheit sichtbar werde. (nar)
→ Infos und Anmeldung Bistumspilgern: www.bistum-stgallen.ch/175jahre/pilgern